Viele Kinder haben große Schwierigkeiten damit, den unterschiedlichen Klang von kurzen und langen Vokalen zu unterscheiden.
Und das verursacht Probleme – denn viele unserer Rechtschreibregeln bauen auf der Unterscheidung der Vokallänge auf.
In diesem Blogartikel erfährst du nicht nur, welche Bedeutung die Vokallängen-Unterscheidung für die Rechtschreibung hat, sondern auch, worauf du achten solltest, wenn du die Unterscheidung von kurzen und langen Vokalen mit Kindern erarbeitest.
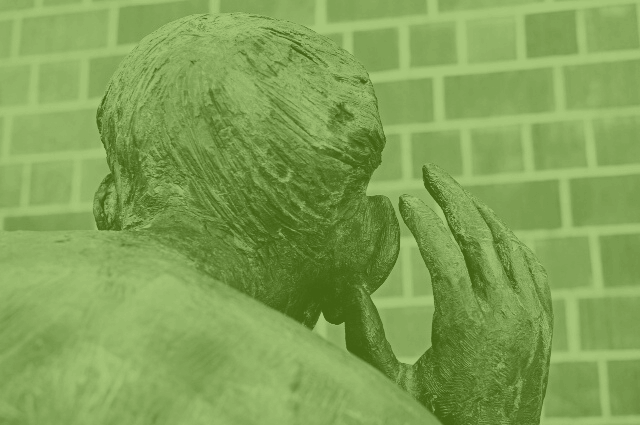
Wenn du Kindern Rechtschreibregeln vermitteln willst, kommst du nicht daran vorbei, die unterschiedliche Vokallänge und ihre Bedeutung für die verschiedenen orthographischen Regeln zu thematisieren.
Denn ob ein einfacher oder ein doppelter Konsonant geschrieben werden muss, hängt davon ab, ob der Vokal an der betonten Stelle des Wortes kurz oder lang gesprochen wird. Die gleiche Frage stellt sich beim gezischten s- Laut, der – je nachdem, ob der vorausgegangene Vokal kurz oder lang klingt – entweder als <ß> wie in “Fuß”, als doppeltes <ss> wie in “Fluss” oder auch als einfaches <s> wie in “Lust” geschrieben wird.
Auch das <ie> wird nur bei einem lang gesprochenen i-Laut geschrieben. Und über das Dehnungs-h, das selbst Erwachsene manchmal grübeln lässt, können wir aufgrund der vielen Ausnahmen von der Grundregel zumindest so viel mit Sicherheit sagen: Es steht niemals nach einem kurzen Vokal.
Doch warum müssen wir uns eigentlich mit all diesen Besonderheiten rumschlagen?
Wozu braucht unsere Schriftsprache doppelte Konsonanten? Warum brauchen wir ein <ß>? Die Schweizer kommen schließlich auch ohne eines aus – dort wird unser <ß> konsequent als <ss> verschriftet.
Besonders den Kindern leuchten unsere Rechtschreibregeln oft nicht ein.
Viele haben große Mühe zu hören, ob ein Vokal nun kurz oder doch lang klingt. Sie mühen sich ab mit Tricks, wie dem überdeutlichen, gedehnten Sprechen, zeichnen Striche oder Punkte mit ihren Fingern in die Luft, versuchen Wörter in “Robotersprache” in Silben zu sprechen und stellen dann frustriert fest, das “mal- len” leider doch nicht richtig ist. Die Frage nach dem Sinn unserer Rechtschreibbesonderheiten ist also durchaus berechtigt.
Welchen Sinn hat sie also – unsere Rechtschreibung?
Die Antwort liegt in der Geschichte unserer Schriftsprache.
Während im deutschsprachigen Raum jahrhundertelang ein ziemlich wilder Mix an Schreibweisen vorherrschte, hat man sich mit Ende des 19. Jahrhunderts auf ein verbindliches Regelwerk für das “Richtigschreiben” geeinigt.
Und diese Einigung hat einen einzigen, tatsächlich sehr sinnvollen, man könnte sogar sagen notwendigen Grund.
Nämlich:
Das, was wir schreiben, muss auch beim Lesen ohne großes Rätselraten verständlich sein.
Und zwar auch dann, wenn Schreiber und Leser aus ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands – mit möglicherweise anderer dialektaler Färbung – stammen. Und auch dann, wenn wir den Schreiber nicht kennen und nicht wissen, worum es in seinem Text gehen könnte.
Wir müssen also richtig schreiben, damit wir richtig lesen können!
Doch was haben die besonderen Schreibweisen im Deutschen nun mit dem Lesen zu tun?
Dafür müssen wir nochmal ein weit größeres Stück in unserer Geschichte zurückgehen. Nämlich zu den Anfängen der Verschriftlichung des Deutschen:
Geschrieben wurde über lange Zeit vor allem in Klöstern und unter Geistlichen. Dafür nutzte man die lateinische Sprache und entsprechend das lateinische Alphabet.
Als dann erstmals auch die deutsche Sprache in Schrift übersetzt wurde, bediente man sich mangels Alternativen ebenfalls am lateinischen Alphabet. Zwar wurden hier und da über die Jahrhunderte ein paar Ergänzungen gemacht. Das <w> etwa kam hinzu, ebenfalls die Pünktchen für unsere Umlaute <ä>, <ö> und <ü> und das etwas sonderbar anmutende <ß>, das aus einer Verschmelzung der Buchstaben <ſ> (= s) und <z> entstand. Andere lateinische Buchstaben blieben erhalten, obwohl wir sie gar nicht brauchen, um die Laute unserer Sprache abzubilden. Das <v> etwa oder das <x>.
Das größte “Manko” bei der Übernahme der lateinischen Buchstaben besteht jedoch darin, dass uns mit dem lateinischen Alphabet nur fünf Vokalbuchstaben (bzw. acht, wenn wir die Umlaute hinzunehmen), zur Verfügung stehen. Die reichen aber nicht mal annähernd, denn das Deutsche ist eine Sprache, die sehr viele Vokallaute hat.
Selbst wenn wir die sogenannten Diphthonge, also die Zwielaute, wie <au>, <ei> oder <eu> außen vor lassen, kommen wir je nach linguistischer Betrachtungsweise auf 14-16 verschiedene Vokalphoneme – also Vokale mit unterschiedlicher klanglicher Qualität. Das sind die vier Grundvokale e, i, o und u und die Umlaute ä, ö und ü , die jeweils zwei unterschiedliche Klangvarianten haben – nämlich als Kurz- und als Langvokal (für das a liegt der Unterschied übrigens tatsächlich nur in der Länge, nicht jedoch in der Lautqualität).
Außerdem gibt es noch den sogenannten “Schwa-Laut” oder “Reduktionsvokal” [ə], wie zum Beispiel in der zweiten Silbe von holen und das sogenannte “vokalisierte r”, wie in „dir“ oder „Garten“ und auch das häufige <er> am Ende von Wörtern wie “Messer” oder “Bauer”, das in unserer gesprochenen Sprache nicht wie der Reibelaut [ʁ] wie z.B. in „Rose“, sondern wie eine Variante von <a> und somit “vokalisch” klingt. In der Lautschrift wird dieser besondere Laut als [ɐ] dargestellt.
Da wir nun aber eben nicht genügend Buchstaben haben, um die vielen verschiedenen Vokallaute im Deutschen zu verschriftlichen, müssen wir uns anders behelfen, um dem Leser deutlich zu machen, wie ein Vokal ausgesprochen werden muss. So zeigen uns zwei oder mehr Konsonanten, die auf einen Vokal folgen (z.B. “Fluss”, “Lust”): Dieser Vokal muss kurz ausgesprochen werden! Ein <ß> (z.B. “Fuß”) zeigt uns an, dass der Vokal davor lang ausgesprochen werden muss.
Sichere Leser und Rechtschreiber können so auch Kunstwörter wie “Trunne” oder “goßen” korrekt lesen bzw. unbekannte Wörter diesen Regeln entsprechend richtig schreiben.
Wenn wir nun Kindern sagen, dass es “kurze” und “lange” Vokale gibt, ist das im Prinzip zwar richtig. Die Sache hat aber einen entscheidenden Haken:
Indem wir den Kindern vermitteln, dass sich der Unterschied nur in der Länge der Aussprache bemerkbar macht, enthalten wir ihnen eine sehr wichtige Information vor. Der Unterschied liegt nämlich gar nicht nur darin, dass der Vokal in einem Wort kurz oder schnell gesprochen wird, während er in einem anderen Wort länger, also gedehnter gesprochen wird. Nein! Kurze und lange Vokale haben – mit einziger Ausnahme des <a> – auch einen tatsächlich deutlich unterschiedlichen Klang!
Sie klingen „lang“ gesprochen so, wie der Buchstabe in unserem Alphabet genannt wird. “Kurz” ausgesprochen bekommen sie jedoch eine ganz eigene Klangqualität! Das erste <e> in Besen, klingt wie der Buchstabe <e> im Alphabet heißt. Würden wir ihn mit dieser Klangqualität in das Wort “Bett” einsetzen, würden wir nicht mehr von einem Möbelstück, sondern von einem “Beet” sprechen.
Die verkürzte Erklärung “Vokale klingen entweder kurz oder lang” kann für die Kinder darum sogar die Schwierigkeit verstärken, den Unterschied zwischen „kurzen“ und „langen“ Vokalen zu hören. Und damit machen wir es den Kindern (und auch uns) unnötig schwer.
Darum ist es ganz essentiell wichtig, mit schwachen Rechtschreibern den unterschiedlichen Vokalklang ganz systematisch zu erarbeiten und die Fähigkeit, diese Unterschiede zu erkennen, intensiv zu üben.
Gute Rechtschreiber unterscheiden den Vokalklang übrigens intuitiv, weil sie die zugrunde liegenden Muster und Systematiken, z.B. dass mehrere aufeinanderfolgende Konsonanten einen kurzen vorausgegangenen Vokal anzeigen, schon verinnerlicht haben.
Das ist übrigens auch der Grund, weshalb manche Kinder Erfolg mit der “Strategie” haben, die Konsonantendopplung über das silbenweise Sprechen herauszufinden. Auch diese Kinder hören die Dopplung nicht (denn sie ist faktisch nicht hörbar!). Was sie jedoch hören und dann für die Anwendung der Regel nutzen, ist der unterschiedliche Klang der Vokale. Sie klatschen “Son-ne” also “richtig”, weil sie sich schon ein unbewusstes, implizites Wissen angeeignet haben, dass das kurze o ein doppeltes <nn> verlangt.
Bevor du mit den Kindern die Regeln der deutschen Rechtschreibung erarbeiten kannst (vier der sieben wichtigsten Rechtschreibphänomene bauen auf der Vokallängen-Unterscheidung auf!), musst du also erst einmal sicherstellen, dass sie “kurze” und “lange” Vokale unterscheiden können.
Und das geht nicht von heute auf morgen!
Darum musst du die unterschiedliche Klangqualität unserer Vokale wirklich intensiv mit den Kindern erarbeiten – vor allem mit Kindern, die Schwierigkeiten in der Rechtschreibung haben. Denn während intuitive Rechtschreiblerner oft schnell in der Lage sind, den unterschiedlichen Vokalklang zu erkennen, gelingt das Kindern mit Unterstützungsbedarf erst nach intensiver Förderung.
Was du bei dieser Förderung unbedingt beachten solltest, haben wir in fünf Tipps für dich zusammengefasst.
Weil sich den Kindern der Unterschied zwischen einem “kurzen” und einem “langen” Vokal meist nicht gut erschließt, wenn ihr die verschiedenen Aussprachevarianten getrennt voneinander betrachtet, solltest du die einzelnen Vokale immer im Kontrast ihrer jeweiligen Klangvarianten erarbeiten. Denn erst in der Gegenüberstellung – z.B. “Dose” vs. “Flosse” – wird der Unterschied im Klang für die Kinder deutlich erfahrbar. Dafür braucht es gezielte Übungen und – besser noch – Forscheraufgaben und Spiele, bei denen die Kinder den Klang der Vokale untersuchen und möglichst eigenständig und selbstentdeckend herausfinden, dass derselbe Buchstabe unterschiedlich klingen kann.
Bei manchen Vokalpaaren ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Klangvarianten größer, bei anderen kleiner. Darum solltest du bei deiner Förderung mit Vokalpaaren beginnen, bei denen sich die “kurze” Aussprachevariante größtmöglich von der “langen” Aussprachevariante unterscheidet. Ein Einstieg in das Thema mit dem Vokalpaar ạ/a wäre z.B. ungünstig, weil der Unterschied zwischen dem kurzen und dem langen <a> sehr gering und für die Kinder besonders schwer herauszuhören ist.
Wenn Kinder den Klang eines bestimmten Vokals heraushören wollen, verfallen sie oft in ein “gedehntes” Sprechen (z.B. “Dooooooose”). Bei vielen Wörtern verfälscht dieses gedehnte Sprechen aber den Höreindruck!
Das zeigt sich besonders an zwei Phänomenen:
Darum: Achte darauf, dass du den Kindern die Wörter immer in einem ganz normalen, natürlichen Sprechtempo vorsprichst, damit auch die Kinder die Vokale beim Sprechen nicht unnatürlich in die Länge ziehen. Denn das würde es ihnen nur erschweren, den Unterschied im Klang zu hören.
Ganz wichtig ist, dass du die Wörter “kurz” und “lang” nicht zu früh benutzt, um damit die unterschiedliche Klangqualität zu bezeichnen. Denn auch wenn die Kinder diese Wörter aus dem Deutschunterricht schon kennen, können sie Verwirrung stiften und Missverständnisse hervorrufen. Nämlich dann, wenn sie (noch) nicht auf der Grundlage eines wirklichen Verständnisses davon genutzt werden, dass die Vokale nicht einfach (in Bezug auf ihre Dauer) kurz oder lang klingen, sondern vor allem unterschiedlich.
Sprich also erst dann von “kurzen” und “langen” Vokalen, wenn du die unterschiedliche Klangqualität stabil erarbeitet hast.
Vielen Kindern fällt es sehr schwer, die feinen Unterschiede im Klang der Vokale herauszuhören. Das zu lernen braucht System, Geduld und Übung!
Lass dich darum nicht dazu hinreißen, das Thema im Schnelldurchlauf durchzugehen, denn das wird dir und den Kindern später beim Erarbeiten der Regeln auf die Füße fallen. Nimm dir also unbedingt ausreichend Zeit! Die ist wirklich nötig, um den unterschiedlichen Klang unserer vielen Vokalphoneme mit den Kindern zu erforschen und zu festigen.
Du möchtest die Unterscheidung kurzer und langer Vokale systematisch mit den Kindern erarbeiten?
Mit unserer bis ins Detail vorbereiteten Fördersequenz zur Vokallängen-Unterscheidung lernen deine Schüler*innen kurze und lange Vokale zu unterscheiden.

Das Förderpaket auf einen Blick:
Lust auf eine kleine Kostprobe?
Komm doch mit uns auf Mini-Expedition!
Die Mini-Expedition schließt sich thematisch an unsere Förderseuenz zur Vokallängen-Unterscheidung an, du kannst sie aber grundsätzlich mit allen Kindern durchführen, mit denen du schon zu den kurzen und langen Vokalen gearbeitet hast.
Sie besteht aus drei komplett ausgearbeiteten Förderstunden, in denen du den Kindern ein zusätzliches Hilfsmittel an die Hand gibst, das sie nutzen können, wenn sie noch unsicher sind, ob ein Vokal kurz oder lang klingt.
Die Mini-Expedition kostet kein Geld! Mehr Informationen findest du hier:
Ursula Bredel, Nanna Fuhrhop, Christina Noak (2017): Wie Kinder lesen und schreiben lernen. Tübingen: Narr Francke Attempto
Nanna Fuhrhop, Jörg Peters (2023): Einführung in die Phonologie und Graphematik. 2. Auflage. Berlin: J.B.Metzler
Wolfgang Steinig, Karl-Heinz Ramers (2020): Orthographie. In: Linguistik und Schule. Von der Sprachtheorie zur Unterrichtspraxis. Tübingen: Narr Francke Attempto
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Active Campaign. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen